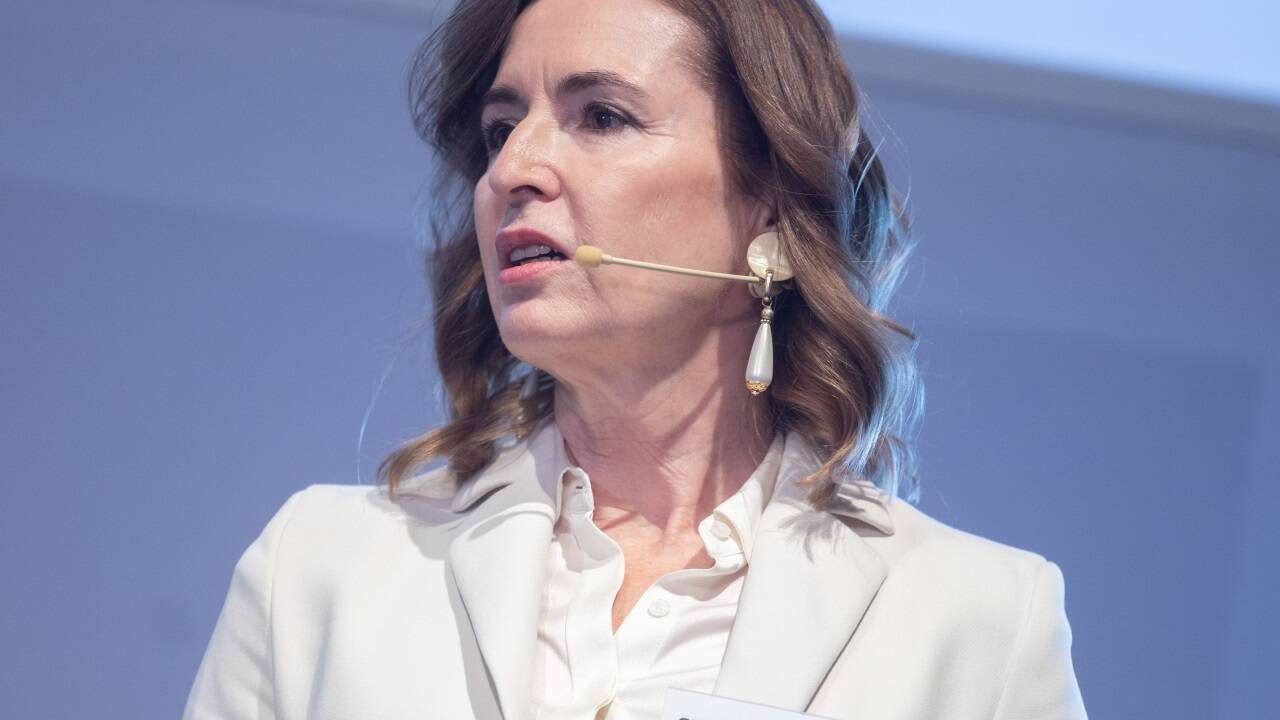- Zum 80. Geburtstag der "Salzburger Nachrichten" haben wir für Sie Geschichten über Begegnungen mit besonderen Menschen geschrieben, die uns im Laufe unseres Berufsweges beeindruckt haben. Unter www.sn.at/80-jahre finden Sie unseren Schwerpunkt "80 Jahre Salzburger Nachrichten".
Was ist mein Selbstverständnis als Journalistin? Das war die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, als das Thema für diese 80-Jahre-Beilage der "Salzburger Nachrichten" in der Redaktionskonferenz erörtert wurde. Zuerst sind es immer die lauten, die schillernden Momente, über die man versucht ist zu schreiben, wenn die Frage nach Menschen, die uns bewegt haben, gestellt wird. Aber geht es dabei nicht mehr um die eigene Eitelkeit denn um das, was diese Begegnungen bewirkt haben? Dazu gehört wohl ein Treffen mit Arnold Schwarzenegger, als dieser in Begleitung seiner damaligen Frau Maria Shriver in der Steiermark für die Special-Olympics-Bewegung einen Baum gepflanzt hat und dabei über die Förderung von intellektuell beeinträchtigten Menschen durch den Sport gesprochen hat.
Das war schon etwas für eine junge Journalistin, damals war Schwarzenegger für österreichische Redakteure noch kaum greifbar. Aber nachhaltig gewirkt hat in dem Zusammenhang jemand ganz anderer. Als ich ein paar Monate später bei den Weltspielen der Special Olympics in Barcelona von einem österreichischen Teilnehmer aus Freude beinahe erdrückt worden wäre und an meine persönlichen Grenzen gestoßen bin, hat mich ein Betreuer dieses Sportlers geschickt und professionell durch die Gespräche mit dem beeinträchtigten jungen Mann geführt. Der Trainer und sein Team haben mich in den gemeinsamen Tagen sehr viel über das Leben von geistig Beeinträchtigten und mit ihnen gelehrt - das ist geblieben.
So wie es immer die eigenen Unzulänglichkeiten als Journalistin und Mensch sind, die Fehler, die man macht, die Dinge, an denen wir scheitern, die schließlich komplettere, im besten Fall bessere Journalistinnen und Journalisten aus uns machen.
Das Schicksal einer Frau hat mich selbst in Träumen verfolgt
Die Frage danach, wer oder was mich journalistisch geprägt hat, wer mich besonders beeinflusst oder bewegt hat, lässt sich daher nicht an spannenden Interviews mit Automobil-Vorstandsvorsitzenden oder schillernden Gesprächen mit Schauspielstars wie Jane Seymour oder an Treffen mit der chinesischen Staatsspitze festmachen. Es sind vielmehr die Geschichten, die nicht erzählt werden, die unser Tun wirklich verändern. Etwa jene Geschichte über Geld, Macht und das Schicksal einer alten Frau, die mir eine Verurteilung durch den Presserat beschert hat. Jenen Presserat, der Missstände im Pressewesen aufzeigt. Es war eine bittere Schmach.
Kurz gefasst ging es in der Causa darum, dass einflussreiche Menschen einer betagten, verschuldeten Frau "geholfen" hatten, indem sie ihr Haus günstig gekauft haben und die Frau danach ins Pflegeheim kam. Ich habe damals die Frau im Heim besucht, sie hat mir viel erzählt, auch, wie unglücklich sie sei. Später hat sie beglaubigt angegeben, ich hätte nicht klar gesagt, dass ich Journalistin sei, und sie habe das alles so nicht gesagt. Jahrelang habe ich immer wieder darüber gegrübelt, was ich falsch gemacht habe, das Schicksal der Frau hat mich selbst in Träumen verfolgt.
Reflexion ist wesentlich für guten Journalismus
Kurz vor ihrem Tod rief die alte Dame mich an, ob ich sie nicht besuchen möchte. Es war ein langes Gespräch, in dem sie sich entschuldigte, dass sie, was mich betrifft, falsch ausgesagt hatte. Nein, das war keine Genugtuung, nur Erleichterung, sie war, glaube ich, ebenso befreit. Aber das, was diese Geschichte für immer bewirkt hat, ist, dass ich seither stets besonders klar und deutlich sage, wer ich bin und was ich mit den Informationen, die mir jemand gibt, zu tun beabsichtige. Darüber mache ich auch Gesprächsnotizen. Nicht aus Angst oder Sorge, dass mir jemand einen Strick daraus drehen könnte. Aber Journalistinnen müssen ins Kalkül ziehen, dass bei anderen etwas anders ankommt, als man zu vermitteln glaubt.
Freilich ist die ehrliche Reflexion in Zeiten starken ökonomischen Drucks, harter Sparmaßnahmen, der Digitalisierung und einer gleichzeitigen Verzagtheit einer Branche, die einen Bedeutungsverlust spürt, schwieriger geworden. Aber diese Reflexion ist wesentlich für guten Journalismus - heute und in der Zukunft. Guter Journalismus klärt auf über die Wirklichkeit, in der wir leben, er gibt Orientierung, bietet Perspektiven, auch außerhalb der eigenen Lebensrealität. Guter Journalismus konfrontiert mit unbekannten Sichtweisen, er ist nicht nur informativ, er hinterfragt Machtstrukturen und thematisiert Missstände. Er arbeitet gegen Widerstände. Neben der Kritik zeigt er Lösungen auf und ist unbequem.
Es ist wichtig, Unbequemes zu berichten
Unbequem zu sein heißt für Journalisten auch, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Eine der größeren, sehr persönlichen Herausforderungen, die mich weit hinter meinen Wohlfühlhorizont gebracht hatte, war der Fall einer jungen Frau, die von einem angesehenen Arzt sexuell missbraucht worden war. Die Schilderung der Erlebnisse jener Frau, die eine Flut von Berichten weiterer Frauen, denen Ähnliches widerfahren war, ausgelöst hatte, war zuerst einmal ein beruflicher Erfolg. Aber einflussreiche Menschen wissen sich oft sehr gut zu wehren. Irgendwann landete ich also nach vielen Gesprächen mit dem Arzt in professioneller Umgebung "zur Aussprache" bei einem Kaffee nicht in seiner Praxis, sondern in seinem Haus. Was folgte, war ein Lehrstück an Manipulation - Psychounterricht gratis nenne ich das heute mit Abstand und vielen Jahren Erfahrung später. Damals ging ich als "Täterin und psychisch labile Person" aus dem Gespräch. Keine Sorge, der Zustand dauerte nicht sehr lange, ich war aber nach dem Gespräch zumindest derart durcheinander, dass ich mein Auto gegen die ärztliche Villen-Steinmauer lenkte.
Ein Phänomen, das Journalistinnen und Journalisten immer wieder erleben. Sie werden manipuliert, persönlich angegangen, verunsichert, in ihrer Glaubwürdigkeit hinterfragt, diskreditiert. Das soll den eigenen Mut mindern, doch es braucht Mut, um guten Journalismus zu machen. Nach der Arzt-Geschichte - der Mann konnte übrigens weiterarbeiten, als wäre nichts geschehen - blieb die Erkenntnis: Es zahlt sich trotzdem aus, Geschichten zu schreiben, die einen Unterschied im Leben von Menschen machen. In diesem Fall waren zumindest die betroffenen Frauen dankbar, dass das Schweigen gebrochen war, und künftige Patientinnen waren alarmiert. Es ist wichtig, Unbequemes zu berichten. Aber das große Lernen als Journalistin war, mich selbst besser zu rüsten, mich nicht allem und jedem unnötig und wohl auch naiv auszusetzen. Etwas, das ich vor allem jungen Kolleginnen und Kollegen versuche mitzugeben. Der übergriffige Arzt war sozusagen auch Lehrmeister. Es kommt nicht darauf an, dass man etwas tun möchte, sondern entscheidend ist, was man wie tut, damit man seine Ziele erreicht.
Es geht um Substanz
Soziale Medien nehmen freilich auf journalistische Kriterien, darauf, dass wir oft Tage, Nächte, Wochen und Monate für Geschichten recherchieren, keine Rücksicht. Sie belohnen den schnellen, banalen Aufreger oder wahlweise überzogene Kritik und schlichte Häme. Das alles gefährdet die journalistische Seriosität und Integrität. Natürlich gibt es auch Journalismus auf Social Media, es sollte sich dabei aber eben um Journalismus handeln, wie etwa die "Salzburger Nachrichten" auf Instagram täglich beweisen. Auch hier geht es nicht um das kurzatmige Abbilden von Aktualität, sondern um Substanz, die mehr zu bieten hat als das, was wir uns schnell im Netz zusammensuchen können. Und dazu braucht es Luft - Luft, um Kontakte zu knüpfen, Luft, um in die Tiefe zu recherchieren. Nur mit Kontakten, die Journalistinnen und Journalisten oft über Jahre pflegen, lassen sich irgendwann die größeren Geschichten erzählen, weil Menschen einem selbst und der Medienmarke vertrauen und auch dann Informationen geben, wenn es für sie nicht so einfach ist. Wie für jenen Manager, dessen Kind aus einem Salzburger Kindergarten geworfen wurde, weil seine Frau in Streit mit einer Politiker-Ehefrau geraten war. Der Manager wollte das ursprünglich nicht in der Zeitung lesen, aber wenn Journalisten über Jahre mit jemandem ein gutes berufliches Verhältnis pflegen, funktioniert dieses auch, wenn es kompliziert wird. Die Geschichte über das Kindergartenkind klang anfänglich nach einer Provinzposse, aber sie zeigte auf, wie manche ihre Ämter und ihre Macht missbrauchen. Die halbe Salzburger Landesregierung musste ausrücken, um den Kommunalpolitiker eines Besseren zu belehren, was zumindest formal gelang. Noch heute muss ich beim Überschreiten der Gemeindegrenze jenes Ortes, in dem sich das zugetragen hat, lachen. Denn immerhin wurde mir damals das Betretungsverbot für die Gemeinde ausgesprochen.
Wer hat mich als Journalistin noch bewegt?
Brenzliger ging es im Gerichtssaal zu, als "falsche" Zahnärzte gegen die "Salzburger Nachrichten" und mich prozessierten. Das Duo hatte viel Geld in Salzburg investiert, aber eben nicht die rechtlichen Voraussetzungen für diese zahnärztliche Klinik. Am ersten Prozesstag war der Anwalt nicht erschienen, und ich übernahm die Verteidigung, motiviert vom Richter, in Eigenregie - zugegeben etwas leichtsinnig, aber vollkommen von der eigenen Recherche überzeugt. Der gegnerische Anwalt und seine Mandanten glaubten, leichte Beute vor sich zu haben, schimpften, drohten und schrien im Gerichtssaal. Kurzum: Die SN haben den Prozess gewonnen und ich die Erkenntnis: Guter Journalismus braucht Mut.
Wer hat mich als Journalistin noch bewegt? Viele hunderte Menschen, denen ich im Lauf der Jahre zugehört habe. Denn das Zuhören, das Ernstnehmen des Gegenübers, das Hinhören, was diskutiert wird, egal, welche Meinung jemand vertritt, ist das Elixier für gute journalistische Arbeit und den persönlichen Alltag.
Zurück zum Selbstverständnis einer Journalistin. Die Texte dieser Jubiläumsausgabe über Menschen, die Journalistinnen und Journalisten bewegen, sind auch deshalb wichtig, weil journalistische Rollenbilder erst dadurch entstehen, dass Menschen über sie und ihr Tun Informationen bekommen, darüber kommunizieren und sich über ihre jeweiligen Vorstellungen von Journalismus austauschen. Denn Rollenbilder sind nicht statisch, sondern permanent neu verhandelbar. Und das ist wichtiger denn je.